| 19. November 2009 So oft
stoße ich mich daran, wenn Medienleute Halbgrößen des Showgeschäftes, vieles zwischen
Glühwürmchen und Sternchen, als "Star" bezeichnen. Was, frage ich stets,
bleibt mir dann als Bezeichnung für reale Größen übrig?
Wie ich grade drauf komme? Im Film "Nikita" (1990) von
Luc Besson hat Jeanne Moreau eine kleine Rolle als "Amande". Allein diese
Sequenzen lohnen es, den Streifen zu sehen.

"Streifen" trifft es hier ziemlich genau. Ich hab
jahrelang keine VHS-Cassetten mehr in die Hand genommen. Nun staune ich über diesen
Effekt der vertrauten Fremdheit beim Umgang mit solchen sperrigen Stücken, denn meine
Hände haben sich so sehr an die DVD gewöhnt.
Ich stelle verblüfft fest, das ich ein ähnlich
wertschätzendes Gefühl für diese andere, nun antiquierte Medienform bekomme, wie es mir
mit Vinyl-Schallplatten ergeht, im Kontrast zur CD. Es war schnell deutlich, was es
ausmacht. Mehr in Händen zu haben, das weniger flott bewegt werden kann. Zeit! Es sind
grundlegend andere Abläufe in der Bedienung. Es ist LANGSAMER.
Was hat mich einst die umständliche Spulerei an den
Cassetten unduldsam gemacht. Plötzlich gehe ich vergnügt damit um. Diese Fragen nach den
Eigenarten verschiedener medialer Formen hatten wir gestern auch in einem ganz anderen
Zusammenhang auf dem Tisch.

Nach einem Plenartreffen von "kunst ost" ging es unter
anderem um die Mittel der Fotografie. Franz Sattler, hier neben der Künstlerin Renate
Krammer, ist ein Meister des Metiers, der seine Werkzeuge genau kennt.
Einiges vom oben beschrieben Kontrast im Umgang, wie er
sich zwischen VHS-Cassette und DVD auftut, finde ich so auch zwischen mechanischen und
digitalen Kameras. Obwohl dieses Gebiet um ein ganzes Universum komplexer ist.
Ich halte es für eine ganz besondere Erfahrung, wenn man
innerhalb der eigenen Biographie solche grundlegenden Umbrüche in unserer Welt der
Werkzeuge und Dinge erlebt. Das widerfährt den Menschen nicht gar so oft. In unserem
Leben häufen sich diese Phänomene zu einem Ausmaß, das meiner Meinung nach sozial und
kulturell kaum noch zu bewältigen ist.

Damit berühre ich erneut den Themenbogen "Vom
Mythos zum Fetisch zur Kunst". Wir bleiben hier wohl bei der Position, daß die
Kunst der Autonomie gewidmet sei und wir Kunstschaffenden die Freiheit haben, unsere
Aufträge und Themen selbst zu wählen.
Doch es zeigen sich gute Gründe, mit den Kompetenzen, die
uns künstlerische Praxis einbringt, zu genau jener Problemlage aktiv zu werden:
Veränderungsschübe, die sozial und kulturell kaum noch zu bewältigen sind.
Genau darin liegt folglich eine gut begründbare
Legitimation für den Anspruch auf öffentliche Mittel. Das sind einige der
soziokulturellen Agenda, die mir in den Kommunen jenseits des Landeszentrums verhandelbar
erscheinen.
Cut
Es ist bloß eine kleine Meldung gewesen (Quelle: "Der Standard"), kaum größer als
eine Briefmarke. Aber es zeigt sich darin eine Geste, die wie ein Wappenmotiv über dem
mutmaßlich ersten wirklich globalen Kulturkonzept steht.
| Der Vater und Herr. Der patriarchale
Herrenmensch. Spender des Lebens, der es auch wieder nimmt, wenn ihm das gefällt. So
tritt er hinter kniende Männer und vor knienede Frauen. Mit einer erigierten Waffe. So kommt es, wenn die Sache todernst wird. Es gibt auch lustige
Versionen der selben Vermessenheit. Ich hab es gestern
am Beispiel "SuperpraktikantIn" notiert. Da zeigt sich ein fröhliches
Herrenmännchen in einer völlig verschnöselten Bundespolitik, als wäre das Land ein
Spielzeugladen, ein Kabarett.
Entsprechend verschnöselt, ja auch: trottelhaft, erweist
sich ein großer Teil des dienstbaren Personals in diesem Theater. |
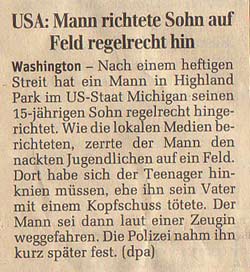 |
Es ist eine Farce auf der
selben Bühne wie die andere, jene vom Vater, der seinem fünfzehnjährigen Kind zum
Scharfrichter wird. Diese verrückte Operette, in der sich jemand längst keine
Rechenschaft mehr über die eigene Erbärmlichkeit gibt. Das führt früher oder später
immer zu Toten, wenn es keine Einwände gibt.
Dieser Scharfrichter ist nur eine
mögliche Konsequenz der gleichen Überheblichkeit, die in viel harmloser scheinendem
Fahrwasser zu blühen beginnt ...
[kontakt] [reset] [krusche] |