| 18. April 2016 Ich
erzähle diesen Teil der Geschichte gerne und wohl noch oft. Es ergab sich aus der Telekommunikation,
daraus wurde ernsthaftes Teleworking. So schrieb ich gemeinsam mit dem
Kulturwissenschafter Matthias Marschik ein Buch. Wir standen uns erst etliche Monate nach
seinem Erscheinen real gegenüber.
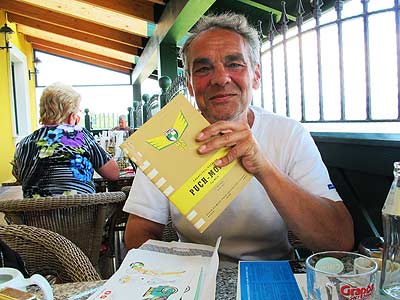
Nun ist unser zweites gemeinsam verfaßtes Buch fertig,
wird demnächst herauskommen und in einem Aspekt der Geschichte wiederholt sich etwas. Ich
sehe in Richard Hollinek einen engagierten Verleger, dem ich bisher noch nie real begegnet
bin. Aber das kommt noch. Verläufe nach meinem Geschmack.
| Das Buch ist demnächst verfügbar. Die
Gestaltung hat Elise Madl besorgt und darin Motive zitiert, die damals unser Leben
prägten, als man zum Beispiel durch das Anstarren üblicher Tapeten einen temporären
Sehschaden erleiden konnte. Madl hat das Buch wie ein
privates Album ausgeführt, was auch sehr schön mit einigen Motiven des Sammelns
korrespondiert. Wir waren ja erstmals eine Generation, die in Sicherheit, Freiheit und
wachsendem Überfluß aufwuchs.
So konnten wir teils über bunte, billige Massenware den
Marotten der Reichen nachkommen, wozu das Sammeln ja gehört. Wir bespielten unsere Zimmer
wie es die Fürsten und Erzbischöfe mit ihren Wunderkammern getan hatten. Ein
Motiv, von dem ich nie freikam und das mit bis heute fesselt. |
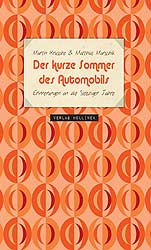
|
Das Buch handelt von einer Ära, da Rauchen
nicht schädlich gewesen ist, Parkplätze immer zu finden waren und überhaupt hatte die
eigene Jugendlichkeit noch so wenig Schaden genommen, daß man sich für unzerstörbar
halten konnte. Berauschend!
Ich hab dann ja hauptsächlich mit Motorrädern geklärt,
was daran bloß Privatmythologie ist und wie eindrucksvoll sich Newtons Physik über jede
Quantentheorie und jede Omnipotenz- Phantasie hinwegzusetzen vermag; kurz, ich brauchte
öfter inspirierte Nothelfer und gute Chirurgen. Aber das spielt in diesem Buch keine
Rolle.
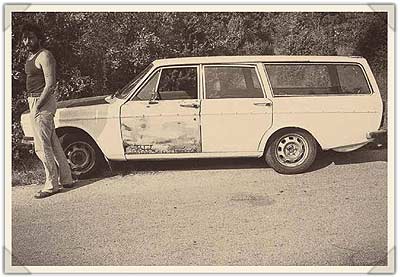
Es hat bloß mein Verhältnis zur Welt
geprägt und mir sehr viel Klarheit über meinen Leib verschafft. Die Publikation kommt
nun aus mehreren Gründen zu einem sehr passenden Moment. Nie war klarer, daß die Zeit
endet, in welcher der Privatbesitz von Verbrennern die Grundlage der individuellen
Mobilität auf Massenbasis war.
Klingt etwas verschachtelt. Bitte in Ruhe noch
einmal durchlesen. Oder so, fraktioniert: Individuelle Mobilität. Ganzer Völker.
Aufgrund des persönlichen Besitzes von Kraftfahrzeugen. Die Von Benzin- oder
Dieselmotoren angetrieben sind, also "Verbrenner".
In den Abgesang dieser Verhältnisse paßt also das Buch
vorzüglich. Hinzu kommt, daß mich in unserer Arbeit gerade einige Aspekt der Popkultur
stark beschäftigen.
Dieses Buch handelt von Zuständen, die eben auch Pop
sind; und zwar auf eine sehr klare, unbeschwerte, unschuldige Art. Wir haben damals keine
Sachdiskurse geführt, sondern uns diesen Motiven einfach hingegeben. Wir waren schlicht
Enthusiasten.

Es ereignete sich ein wenig so wie der
Kontrast zwischen Lateinern und Orthodoxen. Uns interessierte keine
Theologie (Lateiner), nur die Praxis (Orthodoxe). Inzwischen ist freilich viel geschehen.
Reflexionen und Debatten haben sich ausgebreitet. Der Rückblick darauf wird zu einer
Klammer mehrerer Teilprojekte auf dem Weg zu unserem 2016er Kunstsymposion:
-- [Konvergenz: Pop] -- |